Insights 17.10.2025
Warum fragmentierte Stromnetze den Wert von Wohnportfolios gefährden
Jasmin Eckert
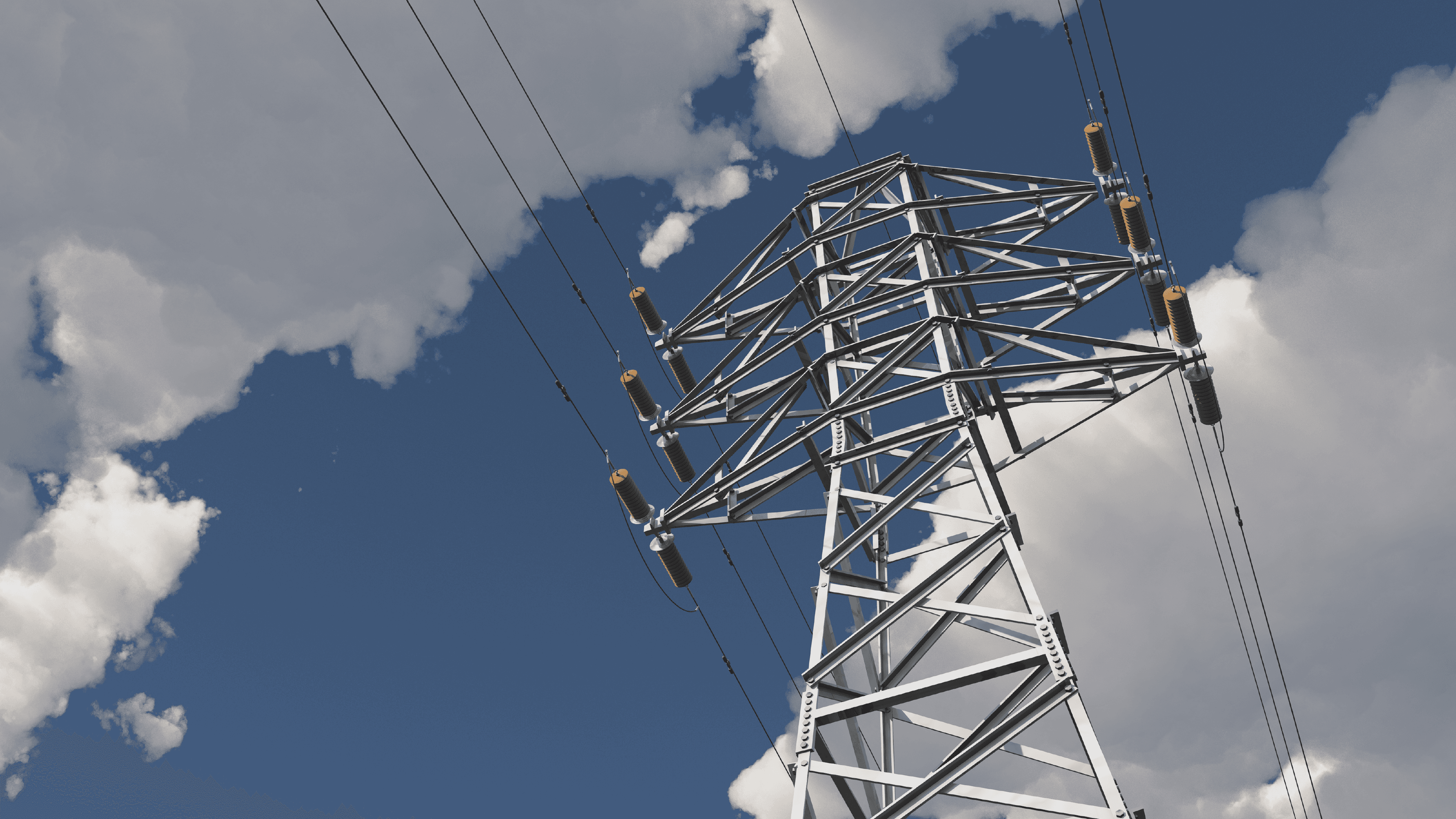
Die Dekarbonisierung des deutschen Gebäudebestands steht vor einer massiven Wende. Die Aufdach-Photovoltaik (PV) und die Wärmepumpe (WP) sind die zentralen Bausteine der Elektrifizierung in Mehrfamilienhäusern (MFH). Die Umstellung auf diese dezentralen Lösungen schreitet rasant voran. Doch während die Technologie verfügbar ist, liegt der wahre Engpass nicht in der Finanzierung, sondern in der Netzbereitschaft und der bunt zersplitterten Hürdenlandschaft der Verteilnetze. Was als technisches Problem der Netzbetreiber erscheint, ist für Wohnungsunternehmen und Immobilieninvestunternehmen eine direkte Bedrohung für die Werthaltigkeit des Portfolios, da es die Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen (ESG) und die Realisierung planbarer Renditen (ROI) blockiert.
Hier sind fünf Hebel, die zeigen, warum ein pragmatischer Netzausbau die Voraussetzung für nachhaltige Renditen im MFH-Bestand ist:
1. CapEx-Stau: Wenn die Wärmepumpe auf den Netzanschluss wartet
Die Elektrifizierung braucht Netzkapazität. Doch im Februar 2025 standen 19.000 Projekte auf der Warteliste für Anschluss und Einspeisung – ein Großteil davon aus dem Immobiliensektor.
Für Investoren bedeutet das: Verzögerte CapEx-Maßnahmen, ROI-Verschiebungen und ESG-Zielverfehlung. Bei PV-Projekten erhalten bis zu 50 % der Investoren eine Absage oder keine Rückmeldung vom Netzbetreiber – bei Batteriespeichern sind es im Schnitt 63 %.
Was auf der Dachfläche technisch machbar ist, scheitert oft an Netzrealität und Intransparenz.
2. Standardisierungsdefizit: Die Netz-Kleinstaaterei als ROI-Risiko
Mit über 850 Verteilnetzbetreibern ist der deutsche Strommarkt zersplittert. Netzanschlüsse werden so leicht zur Einzelanfertigung – mit Wochen oder Monaten Verzögerung.
Für Eigentümer und Asset Manager bedeutet das: Fehlende Planbarkeit bei Mieterstrom, PV-Überbauung oder Speicherintegration. Zur Lösung der Probleme gab es noch unter der alten Bundesregierung eine Reihe von mit den Verbänden diskutierten Maßnahmen, um Netzanschlüsse von erneuerbaren Energien, Verbrauchern und Speichern zu beschleunigen, zu entbürokratisieren und zu digitalisieren. Dies ist augenblicklich noch in der Schwebe. Hier steht die Bundesregierung in der Pflicht, endlich die Dinge voranzubringen, beispielsweise im Energiewirtschaftsgesetz.
Effiziente Dekarbonisierung braucht digitale, einheitliche Prozesse.
Immobilieninvestmentgesellschaften kalkulieren mit stabilen Mieterträgen – doch genau diese geraten unter Druck, wenn Gebäude auf eine fragile Energieinfrastruktur angewiesen sind. Lokale Stromnetzengpässe bremsen Wärmepumpen und gefährden die Versorgung. Was technisch klingt, ist in Wahrheit ein wirtschaftliches Risiko: sinkende Energieeffizienz, unplanbare CO₂-Kosten und potenzieller Wertverlust ganzer Portfolios. Wir müssen aufhören, Infrastrukturprobleme zu unterschätzen. Die Abhängigkeit von lokalen Netzen ist nicht zukunftsfähig. Wer CO₂-neutral wirtschaften will, braucht nicht nur neue Technik, sondern vor allem schnelle Netzanschlüsse.
Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender PAUL Tech AG
3. Flexibilität als Kostenfalle: Warum Marktsignale lokale Netze überfordern
Flexibilität senkt Systemkosten – theoretisch. Doch wenn in einem MFH-Strang mit 10 Ladepunkten alle Wärmepumpen gleichzeitig auf den Strompreis reagieren, entstehen unerwartete Lastspitzen.
Die Folge: Unterdimensionierte Niederspannungsnetze, lokale Blackouts, teure Nachbesserungen.
Empfehlung von Netzplanern: Gleichzeitigkeitsfaktoren um 5–10 % höher ansetzen, wenn marktorientierte Flexibilität geplant ist.
Ohne netzdienliche Steuerung wird Flexibilität zur Falle, besonders in MFH-Portfolios
4. Smart-Meter-Dilemma: Warum der „Flexumer“ auf sich warten lässt
Um WP und Speicher intelligent zu steuern, braucht es Smart Meter (iMSys). Doch bis März 2025 waren erst 2,8 % der deutschen Haushalte damit ausgestattet. Bei Mieterstromprojekten blockiert die bestehende Regulierung die Umsetzung oft um neun Monate – bevor die Technik überhaupt eingebaut wird.
Für Portfoliomanager bedeutet das: Verpasste Einsparpotenziale bei Betriebskosten und längere Amortisationszeiten.
Ohne intelligente Messsysteme bleibt die digitale Wärmewende Theorie.
5. Planungslücke: Warum die Stromnetzplanung zur Pflicht werden muss
Die kommunale Wärmeplanung gibt Investoren Orientierung – aber keine Antwort auf die zentrale Frage: Trägt das Stromnetz die geplante Dekarbonisierung? Die Immobilienwirtschaft fordert deshalb eine verbindliche Stromnetzplanung auf Verteilnetzebene,synchron zur kommunalen Wärmeplanung.
Denn: Ohne verlässliche Ausbauziele drohen Fehl- und Doppelinvestitionen – z. B. eine WP an einem Standort, der kurzfristig ans Fernwärmenetz geht.
Dekarbonisierung braucht sektorübergreifende Planungssicherheit – nicht nur technische Möglichkeit.
Fazit: Der Ball liegt jetzt bei den Netzbetreibern
Die Energiewende im Gebäudesektor scheitert nicht an der Technologie und nicht an der Investitionsbereitschaft. PAUL liefert skalierbare, KI-gesteuerte Wärmelösungen für den Bestand. Unsere Systeme sind einsatzfähig, unsere Kunden wollen umsetzen.
- Was jetzt fehlt, ist ein Stromnetz, das mithält.
- Ein Netz, das nicht bremst, sondern trägt.
- Ein Netz, das Dekarbonisierung nicht verwaltet, sondern ermöglicht.
Der Ball liegt jetzt bei den Netzbetreibern. Wir sind bereit. Für grüne Portfolios. Für resiliente Renditen. Für die Wärmewende im Bestand.